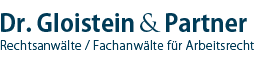Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
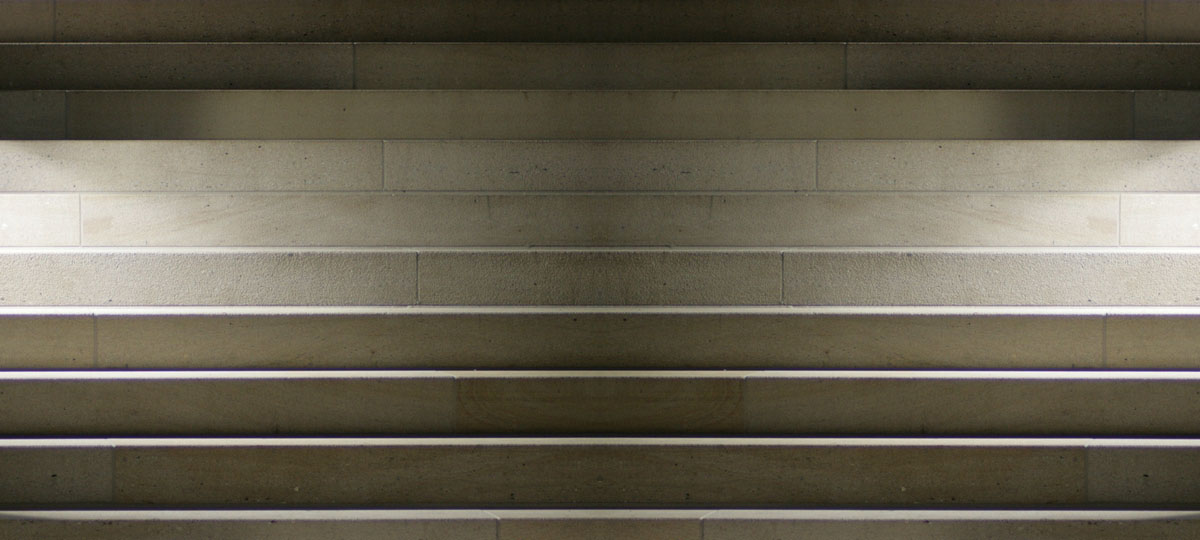
Befristung des Arbeitsverhältnisses mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal – Welche Besonderheiten müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten?
Das Arbeitsverhältnis gemäß §§ 611 ff. BGB ist ein so genanntes „Dauerschuldverhältnis“. Der Arbeitnehmer erbringt auf der Grundlage eines solchen Verhältnisses wiederkehrend seine Arbeitsleistung, dies gegen Zahlung der Arbeitsvergütung.
Der Regelfall eines Arbeitsverhältnisses ist der Unbefristete. Das Arbeitsverhältnis endet dann lediglich aufgrund wirksamer Kündigung durch eine der Vertragsparteien oder durch einvernehmlichen Aufhebungsvertrag. Allerdings ist auch eine Befristung zulässig. Dies setzt
§ 620 Abs. 1 BGB voraus, wonach das Arbeitsverhältnis als besondere Form des Dienstverhältnisses mit dem Ablauf der Zeit enden soll, für die es eingegangen ist (vereinbarte Befristung).
Kann das allgemeine Dienstverhältnis ohne weiteres von den Vertragsparteien befristet werden, gelten für das Arbeitsverhältnis als besonderes Dienstverhältnis Sonderregelungen. Befristungen sind nur unter gesetzlich festgelegten Voraussetzungen zulässig. So soll sichergestellt werden, dass der im Arbeitsverhältnis geltende Kündigungsschutz nicht in unbilliger Weise zu Lasten von Arbeitnehmern umgangen wird.
Der Gesetzgeber hat für Wissenschaftler und Künstler und in diesem Bereich tätiges Personal Sonderregelungen geschaffen.
1. Gesetzliche Befristungsmöglichkeiten
Allgemeine Befristungsregelungen enthält das Teilzeit-und Befristungsgesetz (TzBfG) vom 21.12.2000. Es gestattet zunächst die so genannte „sachgrundlose“ Befristung
(§ 14 Abs. 2 TzBfG). Danach ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig, soweit nicht maximal binnen drei Jahren keine Vorbeschäftigung in einem Arbeitsverhältnis erfolgt ist. Daneben ist die Sachgrundbefristung nach § 14 Abs. 1 TzBfG möglich. Eine solche ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Allerdings muss einer der im Gesetz benannten Sachgründe vorliegen. Die Befristung und letztendlich auch die Befristungsdauer müssen sich am jeweiligen Sachgrund orientieren.
Spezielle Befristungsregelungen für Ärzte in der Weiterbildung finden sich im Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVtrG) vom 15.05.1986. Dieses Gesetz definiert in § 1 Abs. 1 eigenständige Sachgründe für die Befristung eines Arbeitsvertrags mit Ärzten, wenn die Beschäftigung des Arztes seiner zeitlich und inhaltlich strukturierten Weiterbildung zum Facharzt oder dem Erwerb einer Anerkennung für einen Schwerpunkt oder dem Erwerb einer Zusatzbezeichnung, eines Fachkundenachweises oder einer Bescheinigung über eine fakultative Weiterbildung dient.
Die vorstehenden Regelungen werden vom Befristungsrecht des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz-WissZeitVG) vom 12.04.2007 flankiert. Dieses Gesetz und die sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten und -Beschränkungen sind Gegenstand der nachstehenden Betrachtung:
2. Persönlicher Geltungsbereich des WissZeitVG
Das WissZeitVG regelt die besonderen Voraussetzungen für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal. Es erstreckt sich hingegen ausdrücklich nicht auf die Befristung von Anstellungsverträgen mit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern an Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind (§ 1 Abs. 1 WissZeitVG). Es sei darauf hingewiesen, dass unter besonderen Voraussetzungen auch die Arbeitsverhältnisse von nichtwissenschaftlichem und nicht künstlerischem Personal nach den Vorgaben des WissZeitVG befristet werden können
(vgl. z.B. § 2 Abs. 2 S. 2 WissZeitVG).
Was ist aber „wissenschaftliches“ und „künstlerisches“ Personal?
In der Vergangenheit ist die Auffassung vertreten worden, dass die Bundesländer die sog. „Definitionszuständigkeit“ für die Personalkategorie des „wissenschaftlichen und künstlerischen Personals“ haben. Für die so landesrechtlich konkretisierten Beschäftigungsgruppen sollen die Bestimmungen des WissZeitVG zur Anwendung gelangen.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einer jüngeren Leitentscheidung einen abweichenden Standpunkt eingenommen. Es nahm an, der Begriff des „wissenschaftlichen und künstlerischen Personals“ nach § 1 Abs. 1 S. 1 WissZeitVG sei eigenständig und abschließend. Es komme gerade nicht auf Begriffsbezeichnungen oder Zuordnungsdefinitionen nach den landeshochschulrechtlichen Regelungen an. Das BAG argumentiert im Wesentlichen mit dem Sinn und Zweck des WissZeitVG. Mit diesem Gesetz habe der Bundesgesetzgeber entsprechend seiner verfassungsrechtlichen Zuständigkeit für das Arbeitsrecht die bisherigen Regelungen für die Befristung von Arbeitsverhältnissen im Wissenschaft-und Forschungsbereich in einem eigenständigen arbeitsrechtlichen Befristungsgesetz zusammengefasst (BAG, Urteil vom 01.06.2011, 7 AZR 827/09).
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal soll sich nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dadurch auszeichnen, dass es wissenschaftliche bzw. künstlerische Dienstleistungen zu erbringen hat. Dabei bestehen naturgemäß Schwierigkeiten, den Begriff des künstlerischen präzise zu beschreiben. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Tätigkeit wird angenommen, diese umfasse alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist (BAG, Urteil vom 19.03.2008, Az. 7 AZR 1100/06). Sie soll nach Aufgabenstellung und anzuwendender Arbeitsmethode darauf angelegt sein, neue Erkenntnisse zu gewinnen und zu verarbeiten, um den Erkenntnisstand der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin zu sichern oder zu erweitern (BAG, Urteil vom 27.05.2004, Az. 6 AZR 129/03). Zur wissenschaftlichen Dienstleistung soll auch die Vermittlung von Fachwissen und praktischen Fertigkeiten an Studierende und deren Unterweisung in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden gehören. Allerdings sei eine Lehrtätigkeit nur dann als wissenschaftliche Betätigung zu begreifen, wenn dem Lehrenden die Möglichkeit zu eigenständigen Forschung und Reflexion verbleibt. Die wissenschaftliche Lehrtätigkeit sei insofern von einer unterrichtenden Lehrtätigkeit ohne Wissenschaftsbezug abzugrenzen. Demgemäß sollen mit der bloßen Vermittlung von Sprachkenntnissen betraute Fremdsprachenlektoren in der Regel nicht dem Begriff des wissenschaftlichen Personals nach
§ 1 Abs. 1 S. 1 WissZeitVG unterfallen (BAG, Urteil vom 01.06.2011, Az. 7 AZR 827/09).
3. Betrieblicher Geltungsbereich
Das WissZeitVG ist auf alle Einrichtungen des Bildungswesens anzuwenden, die nach dem jeweiligen Landesrecht staatliche Hochschulen sind. Auch nach Landesrecht anerkannte Fachhochschulen zählen dazu (BAG, Urteil vom 18.03.2009, Aktenzeichen 4 AZR 79/09). Das WissZeitVG gilt nicht für Hochschulen, die in privater Trägerschaft stehen und keine staatliche Anerkennung erlangt haben.
Beispielhaft seien als vom WissZeitVG erfasste staatlich anerkannte Hochschulen die Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, die Hochschule der Bundeswehr und die Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft benannt.
Nach § 5 WissZeitVG gelten die Befristungsregelungen dieses Gesetzes auch für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an staatlichen Forschungseinrichtungen sowie an überwiegend staatlich, an institutionell überwiegend staatlich oder auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes finanzierten Forschungseinrichtungen. Gemeint sind hier z.B. die Bundes-und Landesforschungsanstalten, regelmäßig aber nicht privat organisierte Forschungsinstitute und Einrichtungen der Industrieforschung. Diese sollen selbst dann vom WissZeitVG nicht erfasst werden, wenn sie Drittmittel seitens des Bundes oder eines Landes erhalten.
Von besonderer Bedeutung ist, dass die Anwendbarkeit des WissZeitVG nicht davon abhängig ist, wer der jeweilige Arbeitgeber ist. Maßgeblich ist vielmehr, wo die konkrete Arbeitsleistung, die als solche im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich zu begreifen ist, erbracht werden soll (BAG, Urteil vom 24.08.2011, Az. 7 AZR 228/10).
4. Befristungsmöglichkeiten
Die Kernregelungen des WissZeitVG finden sich in dem dortigen § 2. Gemäß § 2 Abs. 1 ist die Befristung von Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem oder künstlerischem Personal, welches nicht promoviert ist, bis zu einer Dauer von 6 Jahren zulässig. Nach abgeschlossener Promotion soll eine Befristung bis zu einer Dauer von 6 Jahren, im Bereich der Medizin bis zu einer Dauer von 9 Jahren, zulässig sein. Insgesamt kommen damit Befristungen von Arbeitsverträgen ohne besonderen Sachgrund für insgesamt 12 Jahren, für Mediziner sogar 15 Jahren, in Betracht.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Dauer einer Befristung von Arbeitsverträgen in der „Post-Doc-Phase“ tragen der Annahme Rechnung, dass Arbeitnehmer im Bereich der Medizin häufig vor dem Hintergrund der Facharztausbildung längere Zeit benötigen, das Ausbildungsziel zu erreichen. Dementsprechend geht das Bundesarbeitsgericht davon aus, dass die Höchstfrist von 9 Jahren im Bereich der Medizin ausschließlich auf Ärzte Anwendung findet, nicht aber auf Wissenschaftler anderer Fachbereiche, die in der klinischen Forschung tätig sind (BAG, Urteil vom 02.09.2002, Az. 7 AZR 291/09). Der „Bereich der Medizin“ soll umfassend zu verstehen sein und auch Tier- sowie zahnärztliche Ausbildungsgänge mit einschließen.
Das WissZeitVG begründet keinen eigenständigen Anspruch von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal, einen befristeten Arbeitsvertrag zu schließen.
5. Ergänzende Anwendung allgemeinen Befristungsrechts
Nach § 1 Abs. 5 WissZeitVG sind die arztrechtlichen Vorschriften und Grundsätze über befristete Arbeitsverträge und deren Kündigung anzuwenden, soweit sie den Vorschriften des WissZeitVG nicht widersprechen. Damit greifen insbesondere Regelungen des TzBfG, so z.B. zum Erfordernis der Schriftform der Befristungsabrede (§ 14 Abs. 4 TzBfG) sowie zur Klagefrist (§ 17 TzBfG).
Soweit der befristet beschäftigte Arbeitnehmer der Auffassung sein sollte, die Befristung des Arbeitsvertrags auf der Grundlage des WissZeitVG sei rechtswidrig, bliebe ihm entsprechend
§ 17 TzBfG lediglich die Möglichkeit, die sogenannte Entfristungsklage beim Arbeitsgericht zu erheben, dies binnen einer Frist von 3 Wochen nach Ablauf des Befristungsdatums!
Fazit:
Gerade im Bereich von Wissenschaft und Forschung sowie im künstlerischen Bereich bestehen besondere Möglichkeiten für Arbeitgeber, Arbeitsverträge zu befristen. Im Einzelfall ist sorgfältig zu prüfen, welche gesetzlichen Vorschriften auf das jeweilige Arbeitsverhältnis Anwendung finden. Danach bestimmen sich die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu beachtenden Gestaltungsmöglichkeiten und -restriktionen. Die fehlerhafte Anwendung von Befristungsregelungen kann schwerwiegende Folgen insbesondere für den Arbeitgeber haben. Im Zweifel besteht das Arbeitsverhältnis dann unbefristet fort. Eine Kündigung desselben wird sich dann häufig als äußerst problematisch gestalten.
Daher sollte schon bei der Vertragsgestaltung äußerst sorgfältig vorgegangen werden. Wir beraten und unterstützen Sie hier gerne.
Kategorien und Themen
- Allgemein (5)
- Arbeitsrecht (163)
- Betriebsverfassungsrecht (38)
- Insolvenzrecht (1)
- Gebühren / Kosten (2)
- Gesellschaftsrecht (4)
- Sozialrecht (1)
- Rentenrecht (1)
- Zivilrecht (2)