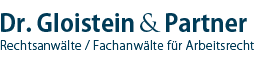Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
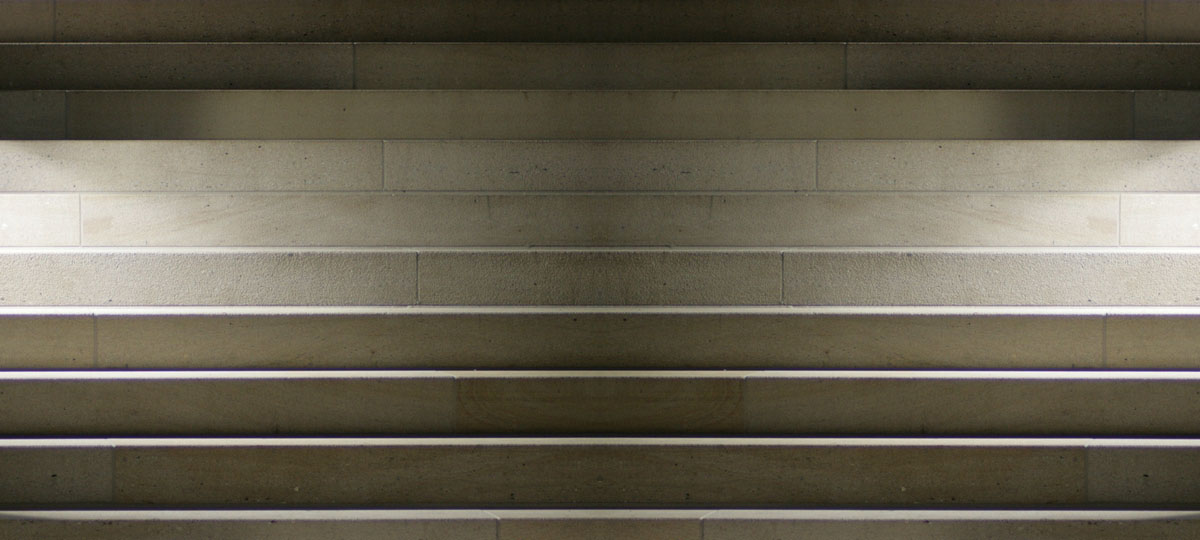
Entgeltfortzahlung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, Spende von Organen oder Geweben, Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation sowie Folgeerkrankung im Arbeitsverhältnis: Worauf müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer achten?
Arbeitnehmer haben im Arbeitsverhältnis grundsätzlich nur dann einen Anspruch auf Zahlung der Arbeitsvergütung, wenn sie auch tatsächlich Arbeitsleistung erbringen. Dies ergibt sich aus der rechtlichen Konzeption des Arbeitsverhältnisses, welches als Austauschverhältnis (Arbeitsleistung gegen Vergütung) ausgestaltet ist. Allerdings entspricht es der sozialen Wirklichkeit, dass Arbeitnehmer nicht durchgängig in der Lage sind, ihre Arbeitsleistung auch tatsächlich zu erbringen. Beispielhaft ist hier auf die Situation krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit und darauf bezogene Folgemaßnahmen (Kur, Reha-Maßnahme) zu verweisen.
Von besonderer Bedeutung ist die Frage, welche Regelungen gelten, wenn der Arbeitnehmer nach zunächst überstandener Krankheit erneut mit der Folge der Arbeitsunfähigkeit erkrankt oder aber nach beendeter Heilbehandlung und zwischenzeitlicher Wiederaufnahme der Arbeit eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation angeordnet wird.
Hier ist auf Folgendes hinzuweisen:
1. Entgeltfortzahlung bei krankheitsbedingter Arbeitsfähigkeit
Gemäß § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit. Voraussetzung für einen solchen Anspruch ist, dass aufgrund einer Krankheit tatsächlich ein Unvermögen zur Leistung der Arbeit eingetreten ist.
2. Unverschuldete Krankheit
Den Arbeitnehmer darf am Eintritt der Arbeitsunfähigkeit auch kein Verschulden treffen. Die Frage eines Selbst-/Mitverschuldens des Arbeitnehmers an eingetretener krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit wird insbesondere bei Sportunfällen sowie Suchtproblematiken diskutiert. Hinsichtlich etwaiger Sportunfälle wird typischerweise zwischen gefährlichen und nicht bzw. weniger gefährlichen Sportarten unterschieden. Erleidet ein Arbeitnehmer bei einer als nicht gefährlich eingeschätzten Sportart eine Verletzung und macht ihm diese Verletzung die Erbringung der Arbeitsleistung unmöglich, besteht grundsätzlich ein Entgeltfortzahlungsanspruch. Anderes wird bei gefährlichen Sportarten angenommen, allerdings ist in der Rechtsprechung völlig unklar, wann von Entgeltfortzahlungsansprüchen ausschließenden Unfällen bei gefährlichen Sportarten auszugehen sein soll. Insbesondere das Bundesarbeitsgericht hat bisher noch keine Sportart als besonders gefährlich eingestuft, auch nicht Amateurboxen BAG, Urteil vom 01.12.1976, Az: 5 AZR 601/75, anders: LAG Saarland, Urteil vom 09.07.1975, Az: 2 Sa 15/75, Drachenfliegen BAG, Urteil vom 07.10.1981, Az: 5 AZR 338/79, Teilnahme an Motorradrennen BAG, Urteil vom 25.02.1972 Az: 5 azr 471/71.
Auch Abhängigkeiten von Alkohol, Drogen, Nikotin, Medikamenten (Tabletten) werden im Regelfall als Krankheiten im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes betrachtet. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts gebe es keinen Erfahrungssatz, dass die darauf beruhende Arbeitsunfähigkeit selbstverschuldet ist (BAG, Urteil vom 01.06.1983, Az: 5 AZR 536/80).
3. Anspruchsdauer und Höhe
Der Anspruch beläuft sich auf einen Zeitraum von höchstens sechs Wochen (42 Tagen). Die Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts bestimmt sich nach § 4 EFZG. Nach § 4 Abs. 1 EFZG ist dem Arbeitnehmer das ihm bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen. Insoweit folgt das Entgeltfortzahlungsgesetz dem so genannten „Lohnausfallprinzip“. Es ist diejenige Vergütung zu zahlen, die zu zahlen gewesen wäre, wäre die Arbeit nicht krankheitsbedingt ausgefallen, vielmehr erbracht worden.
Bei Zeitlohnvereinbarungen ist dann regelmäßig auf den „üblichen“ Dienstplan und die sich daraus ergebende Arbeitsverpflichtung abzustellen. Dem Arbeitgeber ist es auch nicht gestattet, die Dienstpläne nach Bekanntwerden des Eintritts krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit bei einem Arbeitnehmer so zu verändern, dass der Eindruck erweckt wird, der Arbeitnehmer habe nur eine sehr geringe Arbeitsverpflichtung gehabt.
4. Entgeltfortzahlung bei Spende von Organen oder Geweben
Nicht nur krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, vielmehr auch Arbeitsunfähigkeit auf Grund einer vom Arbeitnehmer erfolgten Spende von Organen oder Geweben, kann Grundlage für Entgeltfortzahlungsansprüche sein. Die maßgeblichen Regelungen hierfür finden sich in § 3 a EFZG.
Ist der Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Organen oder Geweben, die nach den §§ 8 und 8 a des Transplantationsgesetzes erfolgt, an seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er nach § 3 a Abs. 1 EFZG einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen.
Besonderheiten ergeben sich in solchen Fällen aber für den Arbeitgeber: Regelmäßig erfolgt eine Spende von Organen oder Geweben fremdnützig. Dem Rechnung tragend verpflichtet der Gesetzgeber die gesetzliche Krankenkasse des Empfängers von Organen oder Geweben, dem Arbeitgeber das an den Arbeitnehmer fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie die hierauf anfallenden, vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu erstatten. Dies erfolgt aber lediglich auf Antrag!
5. Entgeltfortzahlung bei Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation
Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist auch für den Fall vorgesehen, dass Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt werden. Dies regelt § 9 EFZG. Hier solle nach § 9 Abs. 1 EFZG die Regelungen in § 3 EFZG entsprechend zur Anwendung gelangen.
Es ist aber darauf hinzuweisen, dass ein Entgeltfortzahlungsanspruch ausschließlich bei Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird, in Betracht kommt. Hingegen werden Maßnahmen der beruflichen oder sozialen Rehabilitation vom Entgeltfortzahlungsgesetz nicht erfasst; hier bestehen auch keine Entgeltfortzahlungsansprüche!
6. Folgeerkrankung/Anschlusskur
Ist die eine Arbeitsunfähigkeit bewirkende Krankheit behandelt worden und konnte der Abnehmer seine Arbeitsleistung wieder aufnehmen, besteht stets die Gefahr, dass ein „Rückfall“ erfolgt. Ferner findet in vielen Fällen im Anschluss an eine zunächst erfolgreiche Heilbehandlung zu einem späteren Zeitpunkt nach zwischenzeitlicher Arbeitsaufnahme eine Kur oder Rehabilitationsmaßnahme statt. Auch diese beruht dann auf der zunächst behandelten Krankheit.
Hier stellt sich die Frage, inwieweit dann für derlei Fälle erneute Entgeltfortzahlungsansprüche bestehen:
Erkrankt der Mitarbeiter erneut oder nimmt er an einer Kur teil, muss wie folgt unterschieden werden:
Beruht die erneute Arbeitsunfähigkeit auf einer anderen, neuen Krankheit, entsteht ein weiteres Mal ein neuer Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung für die Dauer von sechs Wochen (§ 3 Abs. 1 S. 1 EFZG). Dagegen hat der Mitarbeiter bei einer wiederholten Arbeitsunfähigkeit wegen gleicher Krankheit (sogenannte Folgeerkrankung) grundsätzlich nur den Anspruch auf einmalige Entgeltfortzahlung für sechs Wochen.
Ausnahmen gelten in diesen Fällen nur, wenn
a)
zwischen den beiden Arbeitsunfähigkeiten (also dem Ende der ersten und dem Beginn der zweiten Erkrankung) ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten liegt (dann gilt die zweite Krankheit nicht als Folgeerkrankung)
oder
b)
seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.
Nur in diesen beiden Fällen hat ein Arbeitnehmer trotz Identität der Krankheit einen Entgeltanspruch für einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Wochen.
Dies gilt einschränkungslos auch für den Fall, dass sich nach Behandlung der Erkrankung und Wiederaufnahme der Arbeit dann eine auf die (Erst-) Erkrankung bezogene Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation anschließt.
7. Fazit:
Arbeitgeber/Personalabteilungen haben besondere Sorgfalt an den Tag zu legen, werden arbeitnehmerseitig Entgeltfortzahlungsansprüche geltend gemacht. Stets ist zu überprüfen, ob überhaupt ein solcher Anspruch besteht. Gerade bei Folgeerkrankungen droht eine Überzahlung von Arbeitsvergütung, die in vielen Fällen nicht mehr mit Erfolg rückgängig gemacht werden kann!
Auch Arbeitnehmer haben bei Krankheitsfällen Obacht walten zu lassen, sollten nämlich bei Folgeerkrankungen erneut Entgeltfortzahlungsansprüche bestehen und werden diese nicht geltend gemacht, droht der Verlust jeglicher Zahlungen an den Arbeitnehmer. Auch die Krankenkasse wird in solchen Fällen häufig nicht bereit sein, Krankengeld zu zahlen und den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verweisen.
In dieser Thematik beraten wir Sie gerne.
Kategorien und Themen
- Allgemein (5)
- Arbeitsrecht (163)
- Betriebsverfassungsrecht (38)
- Insolvenzrecht (1)
- Gebühren / Kosten (2)
- Gesellschaftsrecht (4)
- Sozialrecht (1)
- Rentenrecht (1)
- Zivilrecht (2)