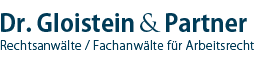Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
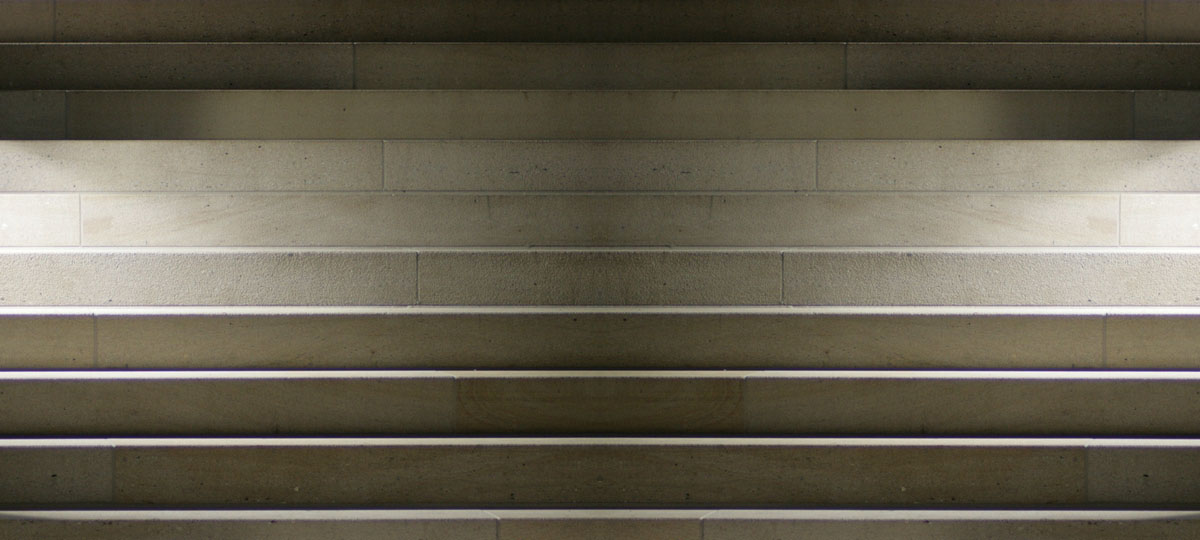
Gesetzliche und vertragliche Regelungen zur Kündigungsfrist im Arbeitsverhältnis – Welche Grenzen sind zu beachten?
Das Arbeitsverhältnis ist ein so genanntes Dauerschuldverhältnis. D.h., es ist von der gesetzlichen Grundkonzeption her auf unbestimmte Dauer angelegt und endet eben nicht mit einer bestimmten Leistung oder einem vorausgesetzten Erfolg. Insoweit ist das Arbeitsverhältnis vom Werkvertrag abzugrenzen. Allerdings ist auch die Befristung des Arbeitsverhältnisses möglich. Einzelheiten hierzu finden sich in §§ 14 ff. des Teilzeit-und Befristungsgesetzes (TzBfG). Im Falle einer wirksamen Befristung des Arbeitsverhältnisses endet dieses mit Fristablauf automatisch.
Handelt es sich aber, wie in der Mehrzahl aller Arbeitsverhältnisse, um ein solches auf unbestimmte Zeit, muss es den Vertragsparteien ermöglicht werden, den Vertrag zu beenden. Gäbe es eine solche Lösungsmöglichkeit nicht, bestünde das Vertragsverhältnis solange, bis eine der Vertragsparteien aufhören würde zu existieren. Dieses würde allgemein als unangemessen angesehen werden, da dann jegliche Möglichkeit der Reaktion auf veränderte Umstände entfielen.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben daher gemäß §§ 620 ff. BGB die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis „ordentlich“ zu kündigen. Die „ordentliche“ Kündigung ist von der „außerordentlichen“ Kündigung abzugrenzen, die gemäß § 626 BGB im Arbeitsverhältnis nur aus wichtigem Grund erfolgen darf.
Im Sinne der Verlässlichkeit und Planbarkeit von Vertragsbeziehungen statuiert das Gesetz bei der ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses einzuhaltende Kündigungsfristen. Diese können von vertraglichen bzw. tarifvertraglichen Kündigungsfristenregelungen überlagert sein.
1. Gesetzliche Mindestkündigungsfristen
Im Arbeitsverhältnis gelten gesetzliche Mindestkündigungsfristen. Diese sind in § 622 BGB geregelt.
Die Grundkündigungsfrist im Arbeitsverhältnis beläuft sich nach § 622 Abs. 1 BGB auf 4 Wochen zum 15. bzw. Monatsende. Diese Kündigungsfrist gilt sowohl für die seitens des Arbeitnehmers als auch die seitens des Arbeitgebers auszusprechende Kündigung.
Diese Grundkündigungsfrist wird von Gesetzes wegen lediglich für den Fall einer vereinbarten Probezeit von längstens 6 Monaten unterschritten. Gemäß §§ 622 Abs. 3 BGB gilt für eine solche Probezeit eine Kündigungsfrist für beide Vertragsparteien von zwei Wochen.
Zu beachten ist aber, dass diese Probezeitkündigungsfrist nicht automatisch zu Beginn eines jeden Arbeitsverhältnisses zum Tragen kommt. Vielmehr müssen die Arbeitsvertragsparteien eine Probezeit tatsächlich im Arbeitsvertrag vereinbaren. Die verkürzte Kündigungsfrist geht nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut nur für eine Höchstdauer von 6 Monaten.
Die Grundkündigungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB verlängert sich nach § 622 Abs. 2 BGB in Abhängigkeit von der Dauer des Arbeitsverhältnisses.
So geht nach zweijährigem Bestand des Arbeitsverhältnisses eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende. Sie verlängert sich um jeweils einen Monat nach 5-, 8-, 10-, 12-, 15- und 20-jährigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses auf bis zu 7 Monate zum Monatsende. Hier ist aber deutlich zu machen, dass die gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist lediglich für vom Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auszusprechende Kündigungen gilt. Bei Kündigungen des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber verbleibt es auch im langjährigen Arbeitsverhältnis bei der Grundkündigungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB! Häufig finden sind sich abändernde Regelungen im Arbeitsvertrag.
In § 622 Abs. 2 S. 2 BGB ist festgelegt, dass bei der Berechnung der kündigungsrelevanten Beschäftigungsdauer Zeiten, die vor der Vollendung des vom 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt werden. Der Europäische Gerichtshof hat diese Regelung für unwirksam, da europarechtswidrig, erachtet (EuGH, Urteil vom 19.01.2010, Az. C-555 / 07). Diese Regelung ist daher nicht anzuwenden.
2. Abweichung von gesetzlichen Mindestkündigungsfristen durch bzw. aufgrund Tarifvertrags
Von der gesetzlichen Mindestkündigungsfristenregelung kann abgewichen werden.
Zunächst kommt eine Abweichung durch tarifvertragliche Regelungen in Betracht, § 622 Abs. 4 BGB. Eine solche Abweichung ist dann ausdrücklich in einem Tarifvertrag zu normieren. Die Regelungen gelten dann für die an den maßgeblichen Tarifvertrag gebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Allerdings sollen Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen in einem Tarifvertrag auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten, die nicht unmittelbar an den Tarifvertrag gebunden sind, wenn der Betrieb in den Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags fällt und die vom Gesetz abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzelvertraglich vereinbart worden sind.
3. Abweichung von gesetzlichen Mindestkündigungsfristen im Arbeitsvertrag
Da § 622 BGB nur den Mindestschutz des Arbeitnehmers im Auge hat, ist es zulässig, die Mindestkündigungsfristen arbeitsvertraglich zu verlängern. Allerdings ist insoweit die Regelung in § 622 Abs. 6 BGB zu beachten, wonach für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer keine längeren Fristen vereinbart werden dürfen als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.
Eine absolute Höchstgrenze für die arbeitnehmerseitig einzuhaltende Kündigungsfrist ergibt sich aus § 624 BGB. Diese beläuft sich auf 5 Jahre.
4. Inhaltliche Überprüfung arbeitsvertraglicher Kündigungsfristenregelungen
Es entspricht immer noch dem Regelfall, dass Arbeitsverträge arbeitgeberseitig vorformuliert und dem Arbeitnehmer vorgelegt werden. In einem solchen Fall beinhaltet der Arbeitsvertrag mit den einzelnen Klauseln „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ im Sinne der §§ 305 ff. BGB.
Gemäß § 305 Abs. 1 BGB sind Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt und die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind, Allgemeine Geschäftsbedingungen. Im Arbeitsverhältnis wird diese Regelung des § 305 in § 310 BGB modifiziert. Hier gilt unter anderem die Regelung in § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB, wonach einseitig vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann als AGB zu begreifen sind, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind.
Allgemeine Geschäftsbedingungen, so auch solche betreffend Regelungen zur Kündigungsfrist, werden insbesondere einer Inhaltskontrolle nach § 307 BGB unterzogen. Zu prüfen ist, ob eine Regelung zu einer unangemessenen Benachteiligung einer Vertragspartei führt. Gemäß § 307 Abs. 1 S. 2 BGB kann sich eine unangemessene Benachteiligung auch daraus ergeben, dass eine Bestimmung im Vertrag nicht klar und verständlich ist. Insoweit nehmen die Arbeitsgerichte eine Transparenzkontrolle vor.
Unklarheiten ergeben sich immer dann, wenn Regelungen mehrdeutig bzw. missverständlich sind. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.
Vielfach finden sich in arbeitsvertraglichen Regelungen derlei Unklarheiten mit der Folge, dass die betreffende Regelung unwirksam ist und nicht Vertragsbestandteil wird. Gemäß § 306 Abs. 2 BGB richtet sich der Inhalt des Vertrags dann nach den gesetzlichen Vorschriften.
Allerdings geht die Rechtsprechung davon aus, dass sich der so genannte „Verwender“ unwirksamer AGB selbst nicht auf die Unwirksamkeit der von ihm vorgegebenen Regelungen berufen darf (BAG, Urteil vom 28.09.2005, Az. 5 AZR 52/05; LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.07.2011, Az. 6 Sa 487/10).
Legt also der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag eine sehr lange beidseitige Kündigungsfrist fest, die über die gesetzlichen Mindestkündigungsfristen hinaus geht, kann er sich selbst bei Unwirksamkeit dieser Klausel hierauf nicht berufen, muss also gegenüber dem Arbeitnehmer die von ihm vorgesehene lange Kündigungsfrist einhalten. Der Arbeitnehmer hingegen kann bei einer von ihm auszusprechenden Kündigung auf die kürzere gesetzliche Kündigungsfristenregelung abstellen.
5. Berechnung der Kündigungsfrist
Die Berechnung der Kündigungsfristen bestimmt sich nach den Regelungen der §§ 187 ff. BGB. Dabei ist der Tag, an dem die Kündigungserklärung bei der anderen Vertragspartei zugeht, nicht in die Berechnung der Kündigungsfrist mit einzubeziehen. Soweit verlängerte Kündigungsfristen von mindestens einem Monat zum Monatsende greifen muss die Kündigung jeweils am letzten Tag eines Monats ausgesprochen werden, um den Folgemonat bei der Berechnung der Kündigungsfrist berücksichtigen zu können.
Fazit:
Im Bereich Kündigungsfristen im Arbeitsverhältnis besteht ein komplexes Zusammenspiel gesetzlicher, vertraglicher und gegebenenfalls tarifvertraglicher Regelungen. Arbeitgeber werden insbesondere bei der Ausgestaltung arbeitsvertraglicher Kündigungsfristenregelungen besondere Sorgfalt an den Tag legen müssen, um am Ende nicht von den möglicherweise schwerwiegenden Folgen arbeitnehmerseitig unbeachtlicher Klauseln überrascht zu werden.
Vor Kündigung des Arbeitsverhältnisses sollte stets eine sorgsame Prüfung der maßgeblichen Fristenregelungen durchgeführt werden.
Wir unterstützen Sie hier gerne.
Kategorien und Themen
- Allgemein (5)
- Arbeitsrecht (163)
- Betriebsverfassungsrecht (38)
- Insolvenzrecht (1)
- Gebühren / Kosten (2)
- Gesellschaftsrecht (4)
- Sozialrecht (1)
- Rentenrecht (1)
- Zivilrecht (2)