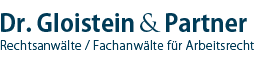Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
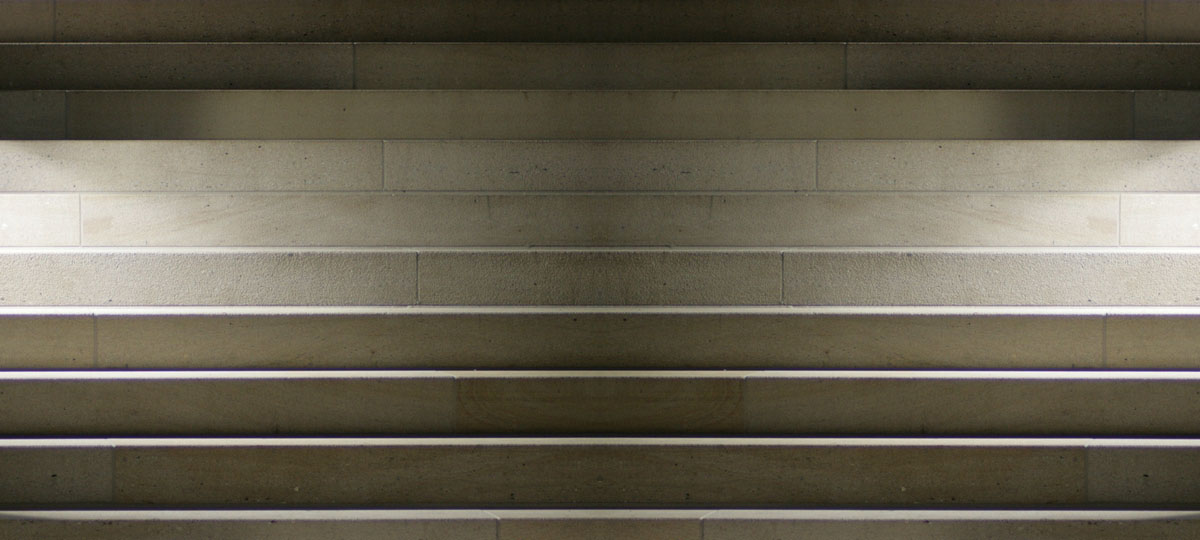
Verzicht auf Kündigungsschutz und Ausgleichsquittung – Gefahren bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses
Wenig ratsam ist der Verzicht des Arbeitnehmers auf Kündigungsschutz nach Ausspruch einer Kündigung.
Im Zusammenhang mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ergeben sich für den betroffenen Arbeitnehmer in der Regel zahlreiche Folgefragen. Zunächst hat der Arbeitnehmer zu prüfen, ob er die Kündigung hinnimmt oder aber ob er Rechtsmittel dagegen einlegt. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen für den Arbeitnehmer häufig noch Ansprüche aus demselben offen. Ungeklärt sind Fragen bezüglich der Urlaubsabgeltung. Vielfach stehen Entgeltansprüche offen.
Spricht der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer die fristlose oder aber die ordentliche Kündigung unter Einhaltung der maßgeblichen Kündigungsfrist aus, ist der betroffene Arbeitnehmer nicht rechtlos. Ihm ist vielmehr die Möglichkeit gegeben, sich gegen die Kündigung mittels Erhebung einer Klage beim Arbeitsgericht zur Wehr zu setzen. Sollte das gekündigte Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate gedauert haben und im Betrieb des Arbeitgebers mehr als 5 bzw. 10 Arbeitnehmer beschäftigt sein, ist die dann erforderliche Kündigungsschutzklage gemäß § 4 KSchG zwingend binnen einer Frist von drei Wochen zu erheben.
Viele Arbeitgeber haben es sich zur Angewohnheit gemacht, dem gekündigten Arbeitnehmer neben dem Kündigungsschreiben ein weiteres Schriftstück zur Unterzeichnung vorzulegen. In einem solchen Schreiben finden sich häufig Klauseln, die den Verzicht auf Erhebung der Kündigungsschutzklage sowie die Geltendmachung noch offen stehender Ansprüche beinhalten. Vielfach sind derartige Erklärungen mit einer vorformulierten Empfangsbestätigung bezüglich des Kündigungsschreibens verbunden. Hier stellt sich dem Arbeitnehmer in der Regel die Frage, ob er verpflichtet ist, ein solches Schriftstück zu unterzeichnen und ob entsprechende Erklärungen bei Unterzeichnung rechtsverbindlich sind.
1. Klageverzicht
Anerkanntermaßen kann der Arbeitnehmer nicht im voraus auf den Kündigungsschutz wirksam verzichten. Sobald jedoch die Kündigungserklärung seitens des Arbeitgebers vorliegt, steht einem Verzicht des Arbeitnehmers auf Rechtsschutz nichts im Wege. Rechtsfolge eines nach Kündigungserklärung erklärten Klageverzichts ist es, dass die Kündigung gemäß § 7 KSchG von Anfang an als wirksam gilt.
Sobald eine solche Verzichtserklärung abgegeben ist, sind kaum noch Möglichkeiten gegeben, diese zu beseitigen. In der Regel wird ein entsprechender Widerruf des Arbeitnehmers rechtlich bedeutungslos sein. Allenfalls kämen eine Anfechtung der Klageverzichtserklärung in Betracht. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass bei Abgabe der Erklärung ein gesetzlich beachtlicher Irrtum des Arbeitnehmers vorgelegen hat (§ 119 BGB) oder aber der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei Abgabe der Erklärung arglistig getäuscht oder bedroht hat (§ 123 BGB).
Zu beachten ist, dass bei Geltendmachung derartiger Anfechtungsgründe der Arbeitnehmer im Rechtsstreit vollumfänglich darlegungs- und beweisbelastet ist. Den Nachweis einer Drohung oder Täuschung wird er in der Regel nicht führen können, wenn keine Zeugen oder andere Beweismittel zur Verfügung stehen. Der Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage birgt erhebliche Gefahren in sich:
Zunächst verliert der Arbeitnehmer jede Möglichkeit, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu erstreiten. Sollte die Kündigung offensichtlich rechtswidrig sein, drohen weitere sozialrechtliche Nachteile:
Konnte der Arbeitnehmer erkennen, dass der Arbeitgeber die Kündigung nicht aussprechen durfte und verzichtet er dennoch auf die Erhebung der Kündigungsschutzklage, droht bezüglich des Bezugs von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe die Verhängung einer Sperrzeit gemäß § 144 Abs. 1 SGB III. Die Sperrzeit beträgt 12 Wochen. Daneben wird die gesamte Bezugsdauer für die Lohnersatzleistung des Arbeitsamtes um ¼ gekürzt.
2. Verzicht auf sonstige Ansprüche
Auch die Erklärung des Verzichts auf sonstige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ist grundsätzlich wirksam. Dem Arbeitnehmer ist im Regelfall die Möglichkeit gegeben, auf die Durchsetzung von Entgeltansprüchen und ähnliche Leistungen des Arbeitgebers zu verzichten. Ausnahmen gelten nur, sofern ein Gesetz den Verzicht ausdrücklich ausschließt. Dies ist beispielsweise bei Ansprüchen auf Erholungsurlaub bzw. Urlaubsabgeltung im Rahmen des gesetzlichen Umfangs der Fall.
Auf rückständigen Lohn kann bedenkenlos verzichtet werden. Probleme ergeben sich auch, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber im Rahmen einer Quittung bestätigt, ausstehendes Entgelt erhalten zu haben. Auch eine solche Quittierung schließt in der Regel die Durchsetzung der jeweiligen Ansprüche aus.
Erklärungen des Arbeitnehmers im Rahmen eines Verzichts bzw. einer Ausgleichsquittung sind in der Regel nicht zu beseitigen. Auch hier kommt allenfalls eine Anfechtung der jeweiligen Erklärungen aufgrund Irrtums, Täuschung und Drohung in Betracht.
3. Pflicht zum Verzicht auf Kündigungsschutzklage und sonstige arbeitsvertragliche Ansprüche
Der gekündigte Arbeitnehmer ist in keinem Fall verpflichtet, auf die Erhebung des ihm zustehenden Rechtsmittels zu verzichten. Gleiches gilt für den Verzicht auf noch offen stehende Ansprüche. Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass der Arbeitnehmer auch eine Empfangsbestätigung bezüglich des Kündigungsschreibens nicht unterzeichnen muss, wenn diese Bestätigung mit der Abgabe der oben näher erläuterten Erklärungen verbunden ist. Es empfiehlt sich, bei Erhalt eines Kündigungsschreibens grundsätzlich keinerlei vorgelegte Schreiben zu quittieren. Eine entsprechende Rechtspflicht besteht wie ausgeführt wurde nicht. Es drohen insoweit auch keinerlei Nachteile bei einer eventuellen Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses.
Kategorien und Themen
- Allgemein (5)
- Arbeitsrecht (163)
- Betriebsverfassungsrecht (38)
- Insolvenzrecht (1)
- Gebühren / Kosten (2)
- Gesellschaftsrecht (4)
- Sozialrecht (1)
- Rentenrecht (1)
- Zivilrecht (2)